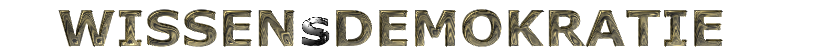Gesamtgesellschaftliche Kostenrechnung
Welche Kosten fallen in unserer Gesellschaft an?
Soziale und ökologische Kosten werden in der Regel nicht in der betrieblichen Kostenrechnung erfasst. Dadurch ergibt sich ein Zerrbild der ökonomischen Wirklichkeit, das nicht die Realität abbildet. Die Internalisierung stellt den Versuch dar, diese Kosten für die Erstellung von Leistungen einzuberechnen.
Internalisierung von ökologischen Kosten
Ökologische Kosten führen zu einer Zerstörung der wirtschaftlichen und sozialen Grundlage unserer Gesellschaft. Der übermäßige Verbrauch endlicher Ressourcen, irreversible Eingriffe in die Natur und eine massive Verschmutzung der Umwelt, gehören zu den größten Bedrohungen in naher Zukunft. Bisherige Modelle der ökologischen Kostenrechnung sahen nur eine Eingliederung der ökologischen Kosten in das betriebliche Kostenrechnungsmodell vor. Die Prioritäten werden im Zweifelsfall, getrieben von der Codierung des Geldes, bei den ökonomischen Kosten gesetzt. Unternehmen besitzen einen mittelfristigen aber keinen langfristigen Planungshorizont. Ökologische Kosten fallen über einen langen Zeitverlauf hinweg an. Bisherige Verordnungen, bspw. zum Gewässerschutz, sind zu allgemein formuliert und die Methode der Kostenerhebung ist nicht eindeutig festgelegt.
Internalisierung von sozialen Kosten
Sozialen Kosten stehen im Spannungsfeld zu ökologischen Kosten und müssen daher in Abhängigkeit zu ihnen betrachtet werden.
Die Zunahme von bestimmten Krankheiten oder die Abnahme der Produktivität von Menschen, sind direkte oder indirekte Folgen von Umweltverschmutzung.
Andere Kosten beinhalten die Ausbeutung von Menschen vor allem in ärmeren Ländern oder die Beanspruchung menschlicher Arbeitszeit, wodurch weniger Zeit für Familie oder Freunde bleibt.
Alllgemein ausgedrückt bedeuten soziale Kosten eine Verschlechterung von Lebensbedingungen, durch die Verkürzung von Lebenszeit und die Verminderung von Lebensqualität.
Daraus wird ersichtlich, dass soziale Kosten stets an den Faktor Zeit gebunden sind, sowohl quantitativ als auch qualitativ.
Mögliche Lösungen sind bspw. Regeln für einen fairen Handel, wie sie die Fair Trade Bewegung fordert. Trotzdem fehlt auch hier ein ganzheitliches Konzept.
(Pseudo-)Effizienz
Momentane Effizienzberechnungen basieren auf Kostenrechnungen die mehrere Arten von Kosten ignorieren. Neben sozialen und ökologischen Externalitäten werden Fragilitätskosten nicht berücksichtigt. Fragilitätskosten entstehen wenn Redundanzen (= eingebaute Sicherheiten für Extremsituationen) abgebaut werden, um andere Kosten zu reduzieren.Eine lokale Tomatenproduktion ist nach konventioneller Kostenrechnung vielleicht wesentlich teurer als eine in einem fernen Land, bietet aber in Krisenzeiten ein viel größeres Ausmaß an Sicherheit. Wichtige ökonomische Entscheidungen werden jedoch nach konventieller Kostenrechnung auf einer Grundlage getroffen, die ein verzerrtes Bild von Effizienz bietet und die Fragilität unseres Wirtschaftssystems erhöht.
Verantwortung für Kosten
Unternehmen berufen sich oft darauf den Willen der Verbraucher umzusetzen und schlicht deren nachgefragte Bedürfnisse zu befriedigen. Demnach tragen die Konsumenten die alleinige Verantwortung für die entstehenden Kosten.
Die Gründe für die Kundennachfrage sind vielfältig:
Verbraucher haben in der Regel nicht den Zugang zu den nötigen Informationen. In den Preisen sind die ökologischen und sozialen Kosten nicht inbegriffen. Preise dienen lediglich zur Kommunikation von Knappheit. Außerdem ist das Budget bei vielen Bürgern nicht ausreichend um einen fairen Preis zu zahlen. Echte Alternativen sind oft nicht vorhanden (Märkte entstehen nicht automatisch von alleine). Es ist auch kein unmittelbarer Zusatznutzen für die eigene Person erkennbar, falls dieser nicht kommmuniziert wird. Der Sinn einer Kaufaktion ist oft nicht erkennbar, da ein erkennbarer Effekt erst bei einer kritischen Masse an beteiligten Personen zu Stande kommt. Schließlich beeinflusst identitätsstiftender Konsum die Nachfrage in hohem Maße (rivalisierende Imitation).
Die Verantwortung wird in der ökonomischen Theorie komplett den Verbrauchern zugeschrieben, ohne dass diese über die nötigen Kompetenzen verfügen. Konsumenten sind Laien. Sie können technische Machbarkeiten oder Kosten nicht einschätzen und haben nicht die Zeit diese Kompetenzen aufzubauen. Der Wachstumszwang, der die Hauptursache für ökologische und soziale Kosten ist, entsteht wenn Zinsen nicht konsumiert sondern gespart und investiert werden. Dies bedeutet, dass nicht der Konsum das ursächliche Problem ist, sondern die Produktion.
Verantwortlich: Ioannis Alexiadis
Literatur:
Göbel, Elisabeth: Ist ethischer Konsum möglich? Vom Praktisch-Werden der Ethik in interdisziplinärer Sicht: Ansätze und Beispiele der Institutionalisierung, Konkretisierung und Implementierung der Ethik; ZTWE, 2015.
Opportunitätskosten sind hypothetische Kosten und können nicht exakt bestimmt werden. Sie sind aber rechtlich garantiert und jeder ist gesetzlich verpflichtet sie zu bezahlen, wenn er mit der Zahlung in Verzug kommt (Strafzinsen). Fragilitätskosten können weitaus größere Auswirkungen haben, werden in der Realität aber völlig ignoriert.
Geld ist ein Medium (Metall, Papier, Pixel) in dem Informationen transportiert werden. Diese Informationen dienen der Kommunikation von Knappheit. Eine Geldeinheit verspricht ihrem Besitzer einen Anteil am zukünftigen Wohlstand einer Gesellschaft. Geld steuert durch diese Informationsvermittlung Verhalten und Entscheidungen seiner Besitzer. Da Kosten in Geldeinheiten erfasst werden, kann eine präzise und allumfassende Kostenrechnung Verhalten und Entscheidungen positiv beeinflussen.